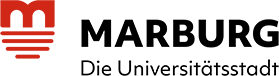Seiteninhalt
Ratsinformation
Beschlussvorlage Stadtverordnetenvers. - VO/0576/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Hochwasserschutzanlagen der Stadt Marburg
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage Stadtverordnetenvers.
- Federführend:
- 66 - Tiefbau
- Bearbeiter*in:
- Marlit Keßler-Retzlaff
- Verfasser*in:
- Herr Plaßmann
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Magistrat
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.09.2004
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Stadtverordnetenversammlung
|
Entscheidung
|
|
|
|
17.09.2004
|
Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden
Beschluss zu fassen:
- Der Bericht über die aktuelle Situation bezüglich der Hochwasserschutzanlagen an der Lahn wird zur Kenntnis genommen.
- Die Deichböschungen im Bereich der Prallufer werden unter Erhalt der größeren Gehölze mit Steinschüttungen saniert, sofern die Deiche bebaute Flächen schützen.
- Bei den restlichen Deichflächen mit unzulässigem Bewuchs werden die Gehölze so gepflegt und zurückgeschnitten, dass die Gefährdung minimiert ist und eine großflächige Schattenwirkung vermieden wird. Auf eine Böschungssanierung wird zunächst verzichtet. Stattdessen werden die Deichkronenwege bei entsprechendem Hochwasser gesperrt.
- Es werden keine Neu- oder Ersatzpflanzungen mehr vorgenommen, sofern nicht durch technische Maßnahmen ein Gehölzbestand ohne Beeinträchtigung der Sicherheit akzeptiert werden kann.
- Zu sanierende Deichabschnitte und Hochwasserschutzmauern werden mindestens so hoch wie das HQ200 (Berechnung von 2002) bzw. das HQ100 + Freibord angelegt.
Sachverhalt
Begründung:
1.
Ausgangssituation
1.1 Bisherige Maßnahmen
Bei einer amtlichen Deichschau in 1995 wurde eine abgängige luftseitige Böschung an einem Teilstück des Bückingdammes festgestellt.
Die Sanierung fand in 1997 mittels einer Spundwand zur Dichtung und Stabilisierung statt.
Im Jahre 1998 wurden die rd. 12 km Lahndeiche im Stadtgebiet einschließlich der Hochwassermauern vom Büro Hartung & Partner, Braunschweig begutachtet.
Bestandteil des Gutachtens war, neben der Standsicherheitsanalyse auch die Überprüfung der Höhenlage anhand von Wasserspiegelberechnungen für verschiedene Hochwasserwahrscheinlichkeiten.
Die Aussagen aus dem Gutachten wurden dem Magistrat am 07.12.1998 und der Stadtverordnetenversammlung am 19.03.1999 vorgestellt.
Damals wurden folgende Beschlüsse gefasst:
„Die
Ergebnisse und Untersuchungen zu den Hochwasserschutzanlagen an der Lahn werden
zur Kenntnis genommen.
Vorbehaltlich
der Einigung mit den betroffenen Anliegern soll im Rahmen der
EU-Förderrichtlinie Interreg II C die Rückverlegung der linksseitigen
Lahndeiche zwischen der Gemarkungsgrenze Cölbe und der Heinrich-Pöttner-Brücke
verfolgt werden. Dazu wird ein entsprechender Förderantrag formuliert.
Die
Sanierung der restlichen Deiche und der Hochwasserschutzmauern erfolgt in den
nächsten 5 Jahren entsprechend der Schadenspriorität.“
Ein weiterer, ursprünglich in der Vorlage vorgesehener Punkt des Beschlusstenors wurde gestrichen:
Eine weitere Bepflanzung der Deiche mit Gehölzen bzw. das Ersetzen abgestorbener Bäume soll unterlassen werden, sofern nicht durch besondere Maßnahmen eine Bepflanzung ermöglicht wird. Eine Beseitigung des vorhandenen Bewuchses wird aufgrund der stadträumlichen Wirkung und der ökologischen Bedeutung der Bäume nicht verfolgt.
Die in diesem Punkt enthaltene Problematik wird weiter unten nochmals aufgegriffen.
Nach Aufteilung der Lahndeiche in verschiedene Abschnitte ergab sich bei dem Gutachten folgendes Schadensbild:

Mit der in 2001 ausgeführten Deichrückverlegung in Wehrda ist der Abschnitt II komplett saniert.
Beim folgenden linksseitigen Abschnitt V unterhalb der Cölber Straße, bei dem ebenfalls ein hoher Handlungsbedarf ausgewiesen wurde, konnte ein ca. 400 m langer Deichabschnitt als Folge des neuen B 3 a-Anschlusses aufgegeben werden, indem der Deich direkt an den Straßendamm der B 3 a angebunden wurde (Ausführung in 2000). Der Sanierungsbedarf ergibt sich am verbleibenden Deich aus der mangelnden Höhe (s. o.). Überflutungsgefährdet sind hier aber nur landwirtschaftliche Flächen, so dass eine Erhöhung des verbleibenden Deiches zurzeit keine hohe Priorität hat.
Höchste Sanierungspriorität besteht nach dem Gutachten am Abschnitt VII (Bereich Mensasteg) und VIII (Trojedamm).
Die dortigen wasserseitigen Böschungen sind zu steil. Es besteht die Gefahr einer Böschungsabrutschung bei ablaufendem Hochwasser, wobei der Deichkronenweg gefährdet ist.
Vertiefende Untersuchungen haben gezeigt, dass die Böschungsinstabilität erst bei einem Hochwasserstand mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 mal in 10 Jahren besteht. Da eine Böschungssanierung ein Eingreifen in den dortigen Bewuchs voraussetzt, wurde bisher von einer Sanierung Abstand genommen. Stattdessen wird der Weg beim kritischen Wasserstand gesperrt.
Abgesehen
von den Böschungsneigungen genügen die vorhandenen Deichquerschnitte den
Anforderungen der Regelwerke (Dichtheit, Standsicherheit etc.). Dies gilt
aber nur für die Bereiche, in denen die Deiche entsprechend den Anforderungen
gehölzfrei sind.
Am Trojedamm wurde die Chance ergriffen, im Zuge der dortigen Neubebauung den Deich so zu verbreitern, dass eine Gefährdung durch die bestehenden Bäume minimiert ist. Gleichzeitig wurde unter Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln der auf dem Deich verlaufende Fuß- und Radweg aufgewertet.
Die
Hochwasserschutzwände wurden hinsichtlich der Höhen der Standsicherheit und dem
äußeren Zustand beurteilt:

Der Abschnitt mit hohem
Handlungsbedarf wurde in 1999 – 2000 im Zusammenhang mit dem Afföller
Wehr saniert und teilweise erhöht. In Verlängerung der Furtstraße fehlte ein
Mauerabschnitt ganz. Diese Lücke wurde ebenfalls geschlossen.
Bei den weiteren Abschnitten besteht
keine Gefährdung der Standsicherheit. Mit Ausnahme der Abschnitte E und F ist
mittelfristig eine Oberflächensanierung von Nöten, um weitere Schäden, z. B.
durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Bisher ist solch eine Oberflächensanierung
nur im Bereich D unterhalb des Afföller Wehres erfolgt.
1.2 Neuere
Entwicklungen
In 2001 gab es erhebliche Schäden durch Starkniederschläge im Bereich der Alpen. Besonders betroffen waren Gebiete in Bayern und Norditalien. Übertroffen wurden diese Ereignisse aber durch das Sommer-Hochwasser an der Elbe 2002. Ein Tiefdruckgebiet, das sich über dem Mittelmeer mit feuchtwarmer Luft anreicherte, zog Richtung Norden und sorgte im Bereich Tschechien und Sachsen für erhebliche Niederschläge. So fielen im Zinnwald innerhalb von 72 Stunden 406 mm Regen, was etwa der Hälfte des Jahresniederschlages von Marburg entspricht. Die Folgen für die Elbe und ihre Nebenflüsse sind hinreichend bekannt. Statistisch gesehen wird das Hochwasserereignis als ein 500-jährliches eingeordnet. In Erinnerung sind wahrscheinlich auch noch das Oderhochwasser in 1997 oder die Rheinhochwasser in 1993 und 1995. Marburg wurde im Februar 1984 von einem 100-jährlichen Hochwasser heimgesucht (Wasserstand 5,33 m). Damals gab es keine größeren Schäden im Stadtgebiet. Trotzdem wurden einige Schwachstellen an den Deichen deutlich, die in folgenden Jahren teilweise beseitigt wurden.
Wie durch zahlreiche Nachfragen im Bauamt deutlich wurde, ist nach dem Elbehochwasser das Problembewusstsein der Marburger Bürger deutlich gestiegen.
Es ist, wenn auch wissenschaftlich nicht eindeutig belegbar, wahrscheinlich, dass durch die eingetretenen Klimaveränderungen (Erwärmung) in Zukunft häufigere oder größere Hochwasser zu erwarten sind. Auf jeden Fall sollten die bisherigen Ereignisse Anlass zur kritischen Betrachtung des Marburger Hochwasserschutzes geben.
Die Ergebnisse der letzten Jahre haben auch den Gesetzgeber zu konsequenterem Handeln bewegt. So hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ein Artikelgesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hoch-wasserschutzes am 03.03.2004 in den Bundestag eingebracht.
Das Hochwasserschutzgesetz ist als Artikelgesetz gefasst. Es sieht Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz, im Raumordnungsgesetz, im Bundeswasserstraßengesetz, im Gesetz über den Deutschen Wetterdienst und im Gesetz über die Umweltver-träglichkeitsprüfung vor.
Wesentliche Punkte des Hochwasserschutzgesetzes sind:
–
die Rückhaltung des Hochwassers als ausdrückliche
Leitlinie der Gewässerbewirtschaftung sowie die Einführung einer allgemeinen
Schadensminderungspflicht,
– die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten,
– die Ermittlung der überschwemmungsgefährdeten Gebiete und den Erlass geeigneter Schutzregelungen,
– die Einführung eines bundesrechtlichen Rahmens für die Hochwasserschutzplanung,
– die Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz mit den betroffenen Ländern und Staaten,
– die nachrichtliche Übernahme von Überschwemmungsgebieten und über-schwemmungsgefährdeten Gebieten in den Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne.
Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Deichaufsicht nachzukommen, wurden die Deiche im Landkreis seitens der Wasserbehörde des Landrates in den Jahren 2002 – 2003 begutachtet.
Die Ergebnisse belegen einen durchweg schlechten baulichen Zustand der Deiche (s. Artikel in der lokalen Presse, bspw. in der OP vom 26.07.2004).
Ausgespart wurde bei den Deichschauen die Stadt Marburg, da bekannt war, dass Marburg sich dem Thema mit der Erstellung des Gutachtens über die Hochwasserschutzanlagen bereits angenommen hatte.
Im Auftrag des Staatlichen Umweltamtes Marburg wurde in 2002 eine Berechnung der Lahn mit einem Hochwasser, das über dem bisherigen Bemessungshochwasser für die Hochwasserschutzanlagen liegt (Wasserstand über 6,00 m), durchgeführt. Es handelt sich um ein Hochwasser mit ca. 200-jährlicher Wahrscheinlichkeit (HQ200). Hieraus ergeben sich Überschwemmungsflächen, die die gefährdeten Bereiche hinter den Deichen und Schutzmauern verdeutlichen (s. Anlage). Diese Bereiche würden überflutet werden, falls Deiche brechen oder überströmt werden sollten. Nach Vorliegen dieser Pläne wurde zusammen mit dem Fachdienst Brandschutz festgelegt, welche Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden müssten.
Die Berechnung im Gutachten vom Büro Prof. Hartung & Partner wurde mit einem HQ100 als Bemessungshochwasser durchgeführt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass das Ohmrückhaltebecken bei Kirchhain voll genutzt werden kann. Demgegenüber verlangt die DIN 19712 „Flussdeiche“ von 1997 eine Bemessung für dichtbebaute Gebiete auf ein Hochwasser größer als HQ100. Das Ohmrückhaltebecken ist frisch saniert. Deshalb ist die volle Einrechnung berechtigt. Besondere Umstände, die einen Volleinstau des Beckens verhindern, sind aber denkbar. Daher gibt die vom RPU beauftragte Berechnung aus 2002 wichtige Hinweise für den Hochwasserschutz.
2. Weiteres
Vorgehen
2.1 Böschungssanierung
und Baumbestand
Den weiter oben gemachten Ausführungen und verschiedensten Fachdiskussionen ist zu entnehmen, dass der Baumbestand auf Deichen und die damit verbundene Durchwurzelung ein ungelöstes Problem darstellen. Ohne Frage sind die Bäume, die die Krone säumen, ein wertvoller Beitrag zur grünordnerischen und städtebaulichen Attraktivität der Stadt. Gleichwohl muss aber der mit dem Hochwasserschutz verbundene Zielkonflikt aufgearbeitet werden, um eine Grundlage für die weitere Vorgehensweise zu erhalten.
Der folgende Auszug aus der DIN 19712 verdeutlicht den Zielkonflikt:
„DIN
19712: 1997-11
12.4
Gehölze
Gehölzbestände
werden entweder durch Pflanzung begründet, oder sie entwickeln sich über die
natürlichen Sukzessionsstadien. Bei unterlassener Pflege können sie langfristig
zu waldartigen Beständen aufwachsen, die auf Deichen grundsätzlich nicht
zulässig sind.
Gehölze
können die Standsicherheit von Deichen durch unterschiedliche Auswirkungen
beeinträchtigen:
-
Bei starkem Sturm kann der Deichboden durch
Baumwurzeln gelockert wer den;
umstürzende Bäume reißen Löcher in den Deich.
-
Bei starken Strömungen und Wellenschlag ist
wasserseitiger Gehölzbewuchs Ansatzpunkt
für eine Deichbeschädigung.
-
Verrottende Wurzeln alter Gehölzbestände und
Wurzelfraß durch Wühltiere können
zu Hohlräumen und Sickerwegen im Deich führen.
-
Die Überwachung von Wühltieren wird unter
Gehölzen erschwert.
-
Starke und dauernde Beschattung unterdrückt
den Graswuchs und schädigt die
Grasnarbe, die den Deich vor Erosion schützt.
-
Die zur Deichüberwachung erforderlichen
Kontrollen, die Deichverteidigung und
die maschinelle Unterhaltung der Deiche werden erschwert.
Wenn
unter Hinweis auf das Landschaftsbild auf eine Bepflanzung von Deichen gedrängt
wird, ist zu beachten:
-
Nicht überdimensionierte Deiche aus
Bodenarten, die eine Durchwurzelung begünstigen,
müssen frei von Gehölzen bleiben.
-
Wasserseitige Böschungen und Bermen,
der Bereich der Deichkrone und alle
Überlaufstrecken sowie überströmbare Teilschutzdeiche sind von Gehöl- zen freizuhalten.
-
Gehölzpflanzungen müssen so angelegt sein,
dass die Wurzeln der Gehölze nicht
in den erdstatisch erforderlichen Deichquerschnitt eindringen.
-
Das untere Drittel der landseitigen
Böschungen muss für Sickerwasserbeo-bachtungen und für die Deichverteidigung
gehölzfrei bleiben.
-
Bepflanzungen sollten in Gruppen vorgenommen
werden. Die Belange der Unterhaltung
sind zu beachten.
-
Bäume sollten vom Deichfuß soweit abgesetzt
sein, dass sie auf der Wasser-seite keine Kolke im Deichbereich verursachen und
mit ihren Wurzeln nicht in den Deich einwachsen können.
-
Normalwüchsige Bäume sollten im Hinterland
einen Mindestabstand von 10 m (Pappel
30 m) vom Deichfuß aufweisen. Sträucher können auch bis zum Deichschutzstreifen hin gepflanzt
werden. Dieser Mindestabstand gilt auch im Vorland
für Bäume, die den Deich vor Eisschäden schützen sollen.
-
Gehölze im Vorland dürfen nicht zu einer
unzulässigen Einschränkung des Hochwasserabflusses
führen.
Gleichlautende Formulierungen finden sich im DVWK-Merkblatt 210/1986 „Flussdeiche“.
Ausführlich wird die Problematik Gehölze und Deiche im DVWK-Merkblatt 226/1993 „Landschaftsökologische Gesichtspunkte bei Flussdeichen“ behandelt.
Hier heißt es:
„Sollen
Deiche neben dem Hochwasserschutz weitere Funktionen mittels Gehölzbewuchs
zugewiesen werden (z. B. aus Gründen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege), müssen sie in Abhängigkeit von den verwendeten
Baumaterialien und deren bodenmechanischen Eigenschaften sowie vom
Abflussverhalten dimensioniert und gestaltet werden, damit durch die geplante
Bepflanzung keine unzulässigen Beeinträchtigungen der Standsicherheit zu
erwarten sind. Deichüberwachung und –verteidigung müssen ohne
Einschränkung möglich sein und der rechnerisch notwendige Abflussquerschnitt
darf durch die Bepflanzung nicht eingeengt werden (siehe Tafel 2).
Der
Deichkörper ist in der Regel stärker zu dimensionieren, zu überhöhen und so zu
gestalten, dass ein Eindringen der Wurzeln in den statisch erforderlichen
Querschnitt nicht möglich ist.“
Mit Ausnahme der verbreiterten Deichabschnitte am Trojedamm sind die Marburger Deiche nicht überdimensioniert. Deshalb gelten die o. g. Ansprüche der DIN 19712 im vollen Umfang.
Bereits im Magistratsbeschluss von 1998 wurde die schon damals diskutierte Beseitigung der Gehölze unter Berücksichtigung des Stadtbildes und der Ökologie als unverhältnismäßig angesehen.
Vor dem Hintergrund der jüngsten Hochwasserkatastrophen und dem damit gestiegenen Problembewusstsein sollte bei einem Verzicht auf die technisch erforderliche Grundsanierung vieler Deichabschnitte die oben dargelegten Hintergründe zumindest soweit berücksichtigt werden, dass auf eine Neu- oder Ersatzpflanzung von Gehölzen auf Deichen verzichtet wird, wenn nicht durch geeignete technische Maßnahmen die Schutzfunktion der Deiche sichergestellt wird.
Viele Deichabschnitte im Stadtgebiet entsprechen nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und bei einem nicht auszuschließenden Versagen im Hochwasserfall wären juristische Auseinandersetzungen mit nachteiligem Ausgang für die Stadt zu erwarten.
Für die Deichabschnitte mit zu steilen Böschungen wie sie in Marburg in 4 Deichabschnitten zu finden sind, wird vom Büro Prof. Hartung & Partner, Braunschweig eine Abflachung der Böschung durch eine Steinschüttung zwischen den vorhandenen Bäumen vorgeschlagen.
Mittel- bis langfristig kann dies dazu führen, dass die vorhandenen Bäume absterben und die sanierten Flächen gehölzfrei bleiben.
Grundsätzlich sollte beim Vorliegen eines Zielkonfliktes Baumbestand – Hochwasserschutz in folgender Differenzierung vorgegangen werden:
Die Folgen eines Deichschadens bei Hochwasser, z. B. durch einen umgestürzten Baum, sind besonders fatal, wenn durch Strömungsangriff der Deich in kurzer Zeit erodiert wird.
In einem geraden Fließquerschnitt ist die Strömung im Bereich des Hauptgerinnes am größten und nimmt nach außen ab. Dies ändert sich in Krümmungen. Dort wandert die Hauptströmung in Richtung des Prallufers (Außenkurve). Der dortige Deich ist besonders gefährdet und sollte deshalb höheren Anforderungen entsprechen.
In den übrigen Fällen sollen zunächst keine technischen, sondern organisatorische Maßnahmen wie unter 1.1 beschrieben (vorübergehende Wegesperrung) vorgenommen werden.
2.2 Deich-
bzw. Mauerhöhe
Eine erforderliche Deichhöhe ergibt sich aus dem Bemessungshochwasser und einen von der Deichhöhe abhängigen Freibord. In Marburg beträgt das Freibord durchweg 0,50 m. Damit liegt die erforderliche Deichhöhe (HQ100 und Freibord) geringfügig unter dem oben beschriebenen außergewöhnlichen Hochwasser HQ200 (ohne Freibord). Einige Deichabschnitte in Marburg sind höher als bisher erforderlich, so dass derzeit nur vereinzelt eine Überströmung bei HQ200 stattfinden würde. Da das bisherige Bemessungshochwasser am unteren Rand der Sicherheitsskala (nach DIN 19712, s. S. 6) liegt, wird vorgeschlagen, das HQ200 ohne Freibord als zweites Kriterium für die Deichhöhe einzuführen und bei Sanierungsmaßnahmen eine entsprechende Höhenentwicklung zu verfolgen.
3. Sanierungsbedarf
3.1 Deichabschnitte
Unter Beachtung o. g. Kriterien ergibt sich auf Grundlage des Gutachtens vom Büro Hartung & Partner für die vorhandenen Deiche in nachfolgender Tabelle zusammen-gestellter Handlungsbedarf.
Dazu wurden vom FD Tiefbau zunächst die Prallufer der Lahn überprüft. Erhöhte Anforderungen werden dabei nur gestellt, wenn der Abstand der Deiche bzw. Hochwasserschutzwände zum Lahnufer weniger als 10 m beträgt. Bei größeren Abständen tritt durch das breite Vorland eine Reduzierung der Fließgeschwindigkeiten auf. Zusätzlich werden höhere Anforderungen nur gestellt, wenn auch bebaute Bereiche zu den zu schützenden Flächen gehören.

Bezüglich der Anforderungen an die Höhe ist zu beachten, dass die Berechnung
des HQ200 vom Büro HGN bisher nur bis zur Südspange vorliegt. Erst
Ende 2004 ist mit den Ergebnissen für die Gemarkungen Cappel, Gisselberg und
Ronhausen zu rechnen.
Der Deichabschnitt III ist unterhalb der Cölber Straße nicht hoch genug. Hier liegt parallel zum Mühlgraben eine Hochwasserschutzwand, die die Bebauung schützt. Eine kurzfristige Überschwemmung des Sportplatzes bei Extremereignissen kann hingenommen werden.
Zu sanieren sind mittelfristig die Abschnitte IV und VI.
Die größte Erhöhung mit 69 cm ist bei Abschnitt V erforderlich. Hier sind in erster Linie landwirtschaftliche Flächen betroffen. Das Gewerbegebiet ist z. T. bereits ab dem HQ100 (Norgine, Medialand) dem Hochwasser ausgesetzt. Dem Baumarkt (OBI) fehlen für das HQ200 25 cm Höhe. Zum Schutz der tieferliegenden Flächen bietet sich die Anschaffung einer mobilen Schutzwand an. Diese besteht aus einzelnen Metallgestellen, die mit Kunststoffplanen bespannt sind und nebeneinander aufgestellt werden. Durch Befüllen der Elemente mit Sand/Boden oder Wasser entsteht eine standfeste, wasserdichte Wand. Bedingung ist ein möglichst ebener, undurchlässiger Untergrund.
Der Baumarkt kann bei einem 200-jährlichen Hochwasser mittels Sandsäcken geschützt werden. Dadurch würde die Erhöhung des gesamten Deichabschnittes V entfallen. Der Deich fungiert dann als sogenannter „Sommerdeich“ mit verminderter Schutzfunktion.
Am Beginn des Deichabschnittes VII herrscht Prallufersituation. Hier ist der Deich beim Hochwasser 1946 gebrochen. Die Folge waren Überschwemmungen in Weidenhausen. Beim HQ200 wäre heute zusätzlich neben der Mensa auch die Feuerwehr und die B 3 a betroffen, die ca. 55 cm tiefer liegt als der Hochwasserstand.
Vom Büro Prof. Hartung & Partner wird eine Sanierung der zu steilen wasserseitigen Böschung vorgeschlagen. Durch Setzen von Wasserbausteinen auf die Böschung kann eine Sicherung unter Erhalt der größeren Gehölze erfolgen. Neben der Absicherung gegen Böschungsbruch verhindern Steine eine flächenhafte Erosion beim Umbrechen eines Baumes.
Der Trojedamm unterhalb der Weidenhäuser Brücke (Abschnitt VIII) ist ab einem HQ10 zu sperren, da die Gefahr des Böschungsbruches bei ablaufendem Hochwasser besteht. Eine Sanierung ist zunächst nur punktuell am Prallufer im Bereich „AquaMar“ vorgesehen.
Am Bückingsdamm ist die luftseitige Böschung so stark bewachsen, dass eine Deichkontrolle oder Deichverteidigung bei Hochwasser nicht möglich ist. Hier muss der Bewuchs soweit zurückgesetzt werden, dass eine geschlossene Grasnarbe entsteht. Die größeren Bäume können im Sinne des oben beschriebenen Kompromisses erhalten bleiben.
Im oberen Bereich des Bückingsdammes (Abschnitt IX) ist der Wasserstand bei HQ200 mit 2 cm unter der Deichkrone auf Deichniveau. Dies sollte bei einer Sanierung des Deichkronenweges durch leichte (~ 5 cm) Anhebung berücksichtigt werden.
Gisselberg wird durch den Deichabschnitt X_A geschützt. Mittelfristig ist dort ein Weg zur Deichverteidigung eingeplant.
3.2 Hochwasserschutzwände
Erhöhte Anforderungen ergeben sich bei den Wänden nicht nur in Bezug auf die Höhe, sondern teilweise auch durch Prallufer, von denen eine Gefahr des Unterspülens der Fundamente ausgeht.

Die geringen Erhöhungen der Abschnitte A und B lassen sich ohne Schwierigkeiten durch Aufsatz einer Kappe, die gleichzeitig eine optische Aufwertung bewirkt, realisieren.
Bei Abschnitt A ist durch heruntergefallenen Putz das Schadenspotential inzwischen so hoch, dass eine umgehende Sanierung vonnöten ist. Ohne Außenputz beginnt der Mauerkern zu verwittern.
Für den Abschnitt D tritt bei HQ200 das Problem auf, dass bedingt durch den geringen Querschnitt der Elisabethbrücke der Aufstau oberhalb überproportional zunimmt.
Nach den Berechnungen fehlen bei diesem Lastfall 60 cm Höhe. Eine Erhöhung um diesen Betrag birgt Standsicherheitsprobleme, was sich in den Baukosten niederschlägt. Zudem würde eine so hohe Wand (~ 1,70 m luftseitig) das Stadtbild erheblich stören.
Da die Gefahr des Überströmens erst etwa ab einem HQ150 beginnt und durch Sandsackauflage auch noch für Hochwässer, die geringfügig höher sind, verhindert werden kann, muss für ein HQ200 ein Überströmen hingenommen werden.
Parallel dazu sollte überprüft werden, ob und wie weit (s. o.) die hydraulische Leistungsfähigkeit der Elisabethbrücke erhöht werden kann.
Für alle weiteren Abschnitte reicht eine mittelfristige Sanierung.
3.3 Gebiete
ohne Hochwasserschutzanlagen
Wird ein Hochwasser betrachtet, dass über den bisherigen Anforderungen liegt (HQ200 ohne Freibord), muss auch untersucht werden, ob Flächen überschwemmungsgefährdet sind, für die bisher keine Hochwasserschutzeinrichtungen vonnöten waren. Dazu wurden Geländehöhen aus der Überfliegung herangezogen. Deshalb sind die Angaben über Wasserstände relativ ungenau (± 10 cm).
Neben dem oben beschriebenen Fall des Gewerbegebietes Wehrda („Im Schwarzen Born“), bei dem der vorhandene Deich zu niedrig ist, sind folgende Stadtgebiete betroffen:
– Bereits bei HQ100 ist der Bereich des Wehrdaer Weges in Höhe der Pöttner Brücke um knapp 20 cm überschwemmt.
Bei HQ200 erhöht sich der Wasserstand auf 75 cm über Straßenniveau. Betroffen ist fast der gesamte Bereich, bei dem die Lahn unmittelbar an den Wehrdaer Weg angrenzt.
Aufgrund der starken Hangneigung sind nur die Gebäude betroffen, die auf Höhe des Wehrdaer Weges liegen.
Durch ein Nivellement sollten die betroffenen Eigentümer ermittelt und in-formiert werden.
– Die Afföllerwiesen gehören bereits zum Überschwemmungsgebiet. In diesem Lastfall ist auch die Straße „Afföllerwiesen“ selbst mit 70 cm Wasserstand einschließlich des Geländes des ehemaligen Gaswerkes betroffen. Das Anwesen Brechlin würde rd. 1,10 m unter Wasser stehen.
– In Höhe der Einmündung Schulstraße liegt die Straße „Am Grün“ rd. 40 cm unterhalb des HW200. Hier ist zu prüfen, ob die Schutzeinrichtungen der lahnseitigen Bebauung ausreichen.
– Die Gisselberger Straße ist etwa ab Höhe des Dienstleistungsbetriebes Marburg (DBM) bis zur Einmündung Stephan-Niderehe-Straße betroffen. Die fehlenden 20 cm lassen sich aber gut durch Sandsäcke ersetzen.
Im Bereich Gisselberger Straße liegt auch ein Prallufer, das mittelfristig gesichert werden muss.
4. Kosten/Förderung
Mit der Aktualisierung der von Büro Prof. Hartung & Partner 1998 ermittelten Sanierungskosten ergibt sich der nachfolgend getrennt nach Deichen und Hochwasserschutzwänden zusammengestellte Mittelbedarf:


Inwieweit für die Gesamtkosten von 1,43 Mio. € Fördermittel aus dem
Programm „Örtlicher Hochwasserschutz“ in Anspruch genommen werden
können, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Gefördert werden lediglich der
Neubau und die notwendige Erweiterung (Erhöhung) bestehender Anlagen mit rd. 30
% der zuwendungsfähigen Kosten. Eine Reaktivierung von Retentionsflächen (z. B.
Deichrückverlegungen) wird aus dem gleichen Programm mit bis zu 70 % gefördert.
5. Zeitplan
Bei optimistischer Einschätzung für die Umsetzung der Maßnahmen wird unter Berücksichtigung der Prioritäten folgender Zeitplan vorgeschlagen:
|
Ausführung |
Maßnahme |
Kosten |
Priorität |
|
2004 |
Deichabschnitt IX |
10.000,-- € |
hoch |
|
2005 |
Wandabschnitt A |
210.000,-- € |
hoch |
|
2005 |
Deichabschnitt VII |
280.000,-- € |
hoch |
|
2006 |
Deichabschnitt V |
30.000,-- € |
hoch |
|
2006 |
Deichabschnitt IV + VI |
250.000,-- € |
mittel |
|
2007 |
Deichabschnitt VIII |
40.000,-- € |
mittel |
|
2007 |
Prallufer Gisselberger Straße |
20.000,-- € |
mittel |
|
2008 |
Deichabschnitt XI |
230.000,-- € |
mittel |
|
2009 |
Deichabschnitt X.A |
60.000,-- € |
mittel |
|
2009 |
Wandabschnitt B |
275.000,-- € |
mittel |
|
2010 |
Wandabschnitt G |
25.000,-- € |
mittel |
Egon Vaupel
Bürgermeister
Anlagen:
–
Power-Point-Präsentation mit Grafiken und Bildern
(Bauausschusssitzung)
– Kommentar „Ein kurzer Sommer“ aus der Frankfurter Rundschau vom 23.08.2004
Kenntnis
genommen und einverstanden
|
6 |
60 |
60.1 |
63 |
61 |
61 SAN |
65 |
66 |
62 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
24 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
33,1 MB
|

- NA
- TOP
- Keine Zusammenstellung
- Dokument auswählen